
Nebenkostenabrechnungen gehören zu den häufigsten Streitpunkten zwischen Mietern und Vermietern. Für viele Haushalte machen die „zweite Miete“ inzwischen einen erheblichen Teil der Gesamtkosten aus. Umso wichtiger ist es, zu wissen, welche Kostenarten rechtlich zulässig sind und welche nicht. Die gute Nachricht: Das Gesetz ist weit klarer, als viele denken. Die Betriebskostenverordnung legt genau fest, welche Posten umlagefähig sind – und was Vermieter nicht abrechnen dürfen.
Was Vermieter abrechnen dürfen
Umlagefähig sind sämtliche Kosten, die laufend entstehen und für den Betrieb oder die Bewirtschaftung des Gebäudes notwendig sind. Dazu gehören unter anderem:
- Heizkosten und Warmwasser
- Wasserversorgung und Abwasser
- Müllentsorgung
- Hausreinigung, Hausmeisterdienste und Winterdienst
- Grundsteuer
- Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen
- Gebäudeversicherung (z. B. Wohngebäudeversicherung)
- Gartenpflege
- Fahrstuhlkosten
- Schornsteinfegerarbeiten
Wichtig ist, dass die Kosten tatsächlich anfallen und vertraglich vereinbart wurde, dass sie umgelegt werden dürfen – entweder im Mietvertrag oder in der Betriebskostenvereinbarung.
Was Vermieter nicht abrechnen dürfen
Viele Mieter zahlen Posten, die rechtlich nicht umlagefähig sind – häufig aus Unwissenheit. Nicht umlagefähig sind unter anderem:
- Verwaltungskosten (z. B. für Büro, Personal, Buchhaltung des Vermieters)
- Instandhaltung und Reparaturen
- Modernisierungen
- Anschaffungskosten (z. B. für neue Mülltonnen, Geräte oder Werkzeuge)
- Rechtliche Beratung oder Gerichtsverfahren
- Bankgebühren des Vermieters
Typischer Fehler: Kosten für den Hausmeister, die reine Reparaturtätigkeiten beinhalten, dürfen nicht umgelegt werden. Nur der Anteil, der zu Reinigung, Pflege oder Betreuung des Gebäudes gehört, zählt als Betriebskosten.
Was du bei der Abrechnung prüfen solltest
Viele Nebenkostenabrechnungen enthalten Fehler – teils versehentlich, teils aus falscher Auslegung. Die wichtigsten Punkte zur Prüfung:
Stimmen die Zeiträume?
Die Abrechnung darf nur ein Jahr umfassen und muss spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums vorliegen.
Ist der Verteilerschlüssel korrekt?
Je nach Mietvertrag können Wohnfläche, Personenanzahl oder Verbrauch Grundlage sein. Ein Wechsel ohne sachlichen Grund ist nicht erlaubt.
Sind alle Posten belegt?
Mieter haben ein Recht auf Einblick in Belege – entweder digital oder vor Ort.
Wurden Reparaturen sauber getrennt?
Wurde ein Hausmeister beauftragt, muss klar sein, welcher Anteil umlagefähig ist und welcher nicht.
Stimmen die Vorauszahlungen?
Was du monatlich gezahlt hast, muss korrekt verrechnet werden.
Viele Mieter scheuen Nachfragen – dabei kann eine einfache Rückfrage oft hohe Nachzahlungen deutlich reduzieren oder in Guthaben umwandeln.
Was du tun kannst, wenn die Abrechnung fehlerhaft ist
Wenn du Zweifel an der Richtigkeit der Nebenkostenabrechnung hast, solltest du zunächst den Vermieter um eine klare, schriftliche Erläuterung bitten. Du hast das Recht, Belege einzusehen, bevor du eine Nachzahlung akzeptierst.
Ergibt die Prüfung Fehler, kannst du schriftlich Widerspruch einlegen. Dafür gilt eine Frist von zwölf Monaten ab Erhalt der Abrechnung. Innerhalb dieser Zeit darfst du Posten beanstanden und Kürzungen verlangen.
Warum es sich lohnt, genau hinzuschauen
Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Nebenkostenabrechnungen Fehler enthält – oft bei Hausmeisterkosten, Gartenpflege, Verwaltungskosten oder Mischpositionen. Für Mieter kann ein genauer Blick schnell dreistellige Beträge sparen. Gleichzeitig hat ein sachlicher Umgang den Vorteil, dass Konflikte mit dem Vermieter vermieden werden.
Fazit
Nebenkosten müssen transparent, korrekt und nachvollziehbar sein. Vermieter dürfen nur laufende Betriebskosten umlegen, nicht aber Verwaltung, Reparaturen oder Anschaffungen. Wer die Abrechnung prüft, Belege einfordert und Unstimmigkeiten meldet, sorgt für Fairness und Transparenz – ohne unnötigen Streit.


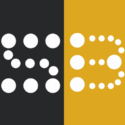
Kommentare