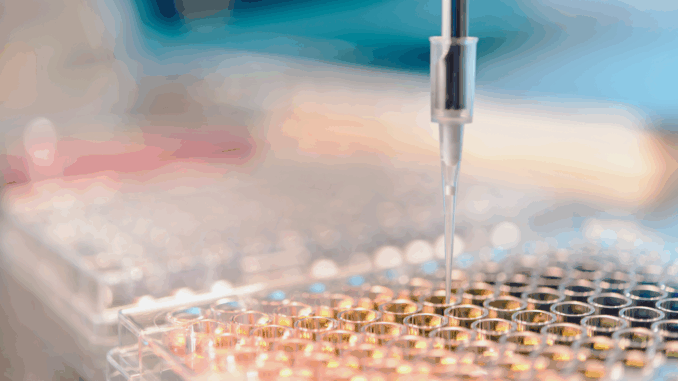
Warum reagieren manche Killerzellen des Immunsystems blitzschnell auf Krankheitserreger – während andere tatenlos bleiben? Diese Frage haben Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), des Universitätsklinikums Erlangen und von Helmholtz Munich jetzt beantwortet.
Das Ergebnis: Unsere Immunzellen treffen eine Art „Kraftentscheidung“. Nur wenn ihre Erkennungsfähigkeit – die sogenannte Avidität – stark genug ist, starten sie die Zellteilung und bilden eine schlagkräftige Abwehrarmee.
Wenn Killerzellen zu „Klonkriegern“ werden
Die sogenannten zytotoxischen T-Zellen, oft einfach „Killerzellen“ genannt, sind die Eliteeinheit des Immunsystems. Sie erkennen körperfremde Moleküle – sogenannte Antigene – etwa von Viren oder Tumorzellen. Jede dieser Zellen hat ihren eigenen „Schlüssel“, den sogenannten T-Zell-Rezeptor, der nur in ein ganz bestimmtes „Schloss“ passt.
Trifft eine Killerzelle auf ihr passendes Antigen, beginnt sie sich zu teilen – und bildet viele identische Nachkommen, die denselben Erreger bekämpfen können. Diese Klone sind wie Kopien derselben Soldatin im Abwehrsystem. Doch: Nicht jede Begegnung führt zu dieser Zellvermehrung.
Erkenntnis aus Covid-Impfung
Um herauszufinden, wann Killerzellen aktiv werden, untersuchten die Forschenden Menschen nach einer mRNA-Impfung gegen Covid-19. Dabei stellte sich heraus: Nur jene Zellen, deren Rezeptoren stark genug an das Virusprotein binden konnten, vermehrten sich anschließend. „Killerzellen teilen sich nur, wenn ihre Bindungsstärke – also ihre Avidität – über einem bestimmten Schwellenwert liegt“, erklärt Prof. Dr. Kilian Schober vom Institut für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der FAU.
Vielfalt ist die beste Verteidigung
Nach der Impfung bildeten sich bei den Testpersonen rund 20 bis 30 verschiedene Killerzell-Klone. Jeder dieser Klone hatte leicht unterschiedliche Rezeptoren – eine Art biologischer Mix, der das Immunsystem anpassungsfähiger macht. „Diese Vielfalt ist enorm wichtig“, so Schobers Doktorandin Katharina Kocher. „Wenn das Virus mutiert, gibt es dadurch immer noch Zellen, die es erkennen können.“ Ein einzelner Zelltyp allein könnte diese Aufgabe nicht erfüllen.
Forschung mit großem Aufwand
Für die Studie analysierte das Team Tausende einzelner Killerzellen und rekonstruierte über hundert Rezeptoren im Labor. Mit diesem Aufwand gelang ein seltener, tiefer Einblick in die Strategien des menschlichen Immunsystems.
Die Ergebnisse, veröffentlicht in Science Immunology, könnten künftig helfen, bessere Impfstoffe zu entwickeln – solche, die gezielt starke, aber auch vielfältige Immunantworten auslösen.


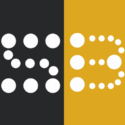
Kommentare